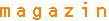| magazin |


art from the uk
|
|
|
|
Und nun so was. Da organisiert sich 1988 ein Haufen Goldsmith’s College Studenten, allen voran der damals 22jährige Damien Hirst, zu einer Gruppenausstellung in den Londoner Docklands und läßt der Kunstöffentlichkeit mit „Freeze“ das Blut in den Adern gefrieren - Hirsts Tier-Kadaver in Formaldehyd sind längst als Klassiker zu bezeichnen. Unter ihrem Lehrer Michael Craig-Martin lernten die Jung-Stars, nicht nur das ‘Wie’, sondern auch das ‘Was’ und ‘Warum’ ihrer Kunst zu befragen und vor allem in Szene zu setzen. Und dazu gehört eben auch die Provokation, die heute als Vermittler zwischen Werk und Betrachter formaler Selbstzweck werden kann, was in diesem Fall durchaus positiv zu verstehen ist. Zumindest ist sie nämlich ein Garant, die Aufmerksamkeit der reizüberfluteten und -übersättigten Öffentlichkeit zu erregen.
Die Sammlung Goetz zeigt unmittelbar nach „Full House“ im Museum Wolfsburg nun mit „Art from the UK, Teil I“ vor allem weniger bekannte Künstler einer zweiten Generation, die seit Anfang der 90er Jahre mit der bekannten Frechheit große Themen wie Tod, Vergänglichkeit und Sexualität inszenieren.
|
|
Beinahe besinnlich wirken im Vergleich die Matratzenabgüsse Rachel Whitereads im ersten Stock, die ja bekanntermaßen aus ästhetisch einwandfreiem Kunstharz bestehen und die Körpergerüche ihrer ehemaligen Benutzer nur gedanklich evozieren.
Das dekorative Tapetenmuster des Nachbarraums erweist sich dagegen als handfester Abdruck eines Hinterteils. Das überdimensionale Stempelkissen, mit dem diese Unmöglichkeit entstanden sein könnte, hat Abigail Lane gleich als Sitzfläche eines Stuhles und als monumentales Tafelbild mitgeliefert. Die detektivische Spurensuche des Betrachters führt über offensichtliche erotische Konnotationen und subtile Anspielungen auf die Performance Art der 60er Jahre zur menschlichen Identität in der Gesellschaft. Nicht nur hierin sind die Arbeiten Abigail Lanes den Werken Robert Gobers verwandt; schon die Inszenierung eines Wohnraumes mit provokantem Tapetenmuster und verfremdeten Möbeln sind ein unmißverständliches Zitat.
Zuletzt wird der
Besucher selbst zum Objekt der Kunst. Douglas Gordon verführt
uns zu einem Leseexperiment der besonderen Art: „30 Seconds Text“
sind in einer Dunkelkammer zu sehen, aber eben genau nur 30 Sekunden
lang. Dann erlischt die Lampe. Wer hier nicht schnell genug mitliest,
steht im Dunkeln und hat die Pointe verpaßt.
Also:
Anrufen, Hingehen, Mitmachen! Denn auch wer bis jetzt nicht kapiert
hat, daß BritArt mindestens so angesagt ist wie die Verkündigung
an die Jungfrau Maria kurz vor Weihnachten, kriegt selbst bei
Douglas Gordon garantiert noch eine zweite Chance.
Erster Teil noch bis 28. Februar in der Sammlung Goetz. Zweiter Teil 30. März - 2. August 1998. Besichtigung nur nach telefonischer Vereinbarung (Tel.: 089/9578123). Zur Ausstellung erscheint ab Ende Dezember ein Katalog (dt./engl.).