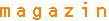| magazin |


irving penn oder die dauer der photographie
|
|
|
|


Aktphotos, die er zwar seit 1950 fertigte, aber erst 1980 öffentlich präsentierte, stehen für eine weitere photographische Facette. Zeitlich parallel und dennoch ganz anders geartet, riefen Stilleben aus Müll und Zigarettenkippen Erstaunen hervor. Beide Themen lassen allerdings auf eine rege Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst schließen.
|
|


|
|


Als logische Konsequenz wurde das Penn'sche Repertoire von nachfolgenden Künstlern wiederaufgegriffen. Vor dem unwiederbringlichen Picassoporträt (1957) verneigten sich z.B. junge Photographen in der Form des Plagiats (Tillmann & Vollmer, "Pablo Gruber", 1984). Wer Stefan Moses Porträtserien der Deutschen (1980 publiziert) kennt, weiß spätestens jetzt um seinen geistigen Ziehvater.
Als fürchte er dennoch die Unbeständigkeit seiner Lichtbilder, ist in den jüngeren Arrangements des heute achzigjährigen Irving Penn die zeitliche Dauer ein motivisches Thema. Ein humorvoller Zug biegt die vermeintliche Dramatik aber ab, indem er beispielsweise zwei Menschenschädel zum Liebespaar (The Poor Lovers, 1979), oder Knochen zum Memento Mori zusammenbringt.
Sich selbst setzte er ein Denkmal, indem er sein Archiv dem Art Institute in Chicago schenkte, womit er seiner Aufarbeitung Vorschub leistete. Doch sein eigentliches Vermächtnis ist seine Allgegenwärtigkeit.