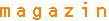| magazin |


Vom Schlamm zum Kristall
|
|
|
|


1911 entdeckt Feininger dann die Bilder der Kubisten Braque und Picasso. Ihre Analytik verhilft ihm zur eigenen, reinen Bildform aus splittrigen Bausteinen. Die strukturbildenden Elemente für seine Bildarchitektur erschaut er sich aber in der Baukunst selbst. In den Bildern der Kriegsjahre wird Feininger vor allem die thüringischen Dorfkirchen um Weimar zu monumentalen „Kathedralvisionen“ erhöhen und hierbei vom facettierten, reliefhaften Flächenplan der Kubisten zur Durchdringung der Motive in die Tiefe des Bildes vordringen. In der Monochromie lehmigen Brauns und trüben Grüns, tonlosen Graus und matten Indigoblaus wird er sich aber noch eine Weile in der „farblosen“ Gefolgschaft des Kubismus aufhalten.
Der Festigkeit seiner Kompositionen fügt Feininger aber auch dynamische Aspekte hinzu, wie er sie im italienischen Futurismus mit Keilformen, aufsteigenden und abstürzenden Kraftlinien sehen konnte. Wie die Italiener wollte auch Feininger sich selbst und damit den Betrachter mitten in das Kraftfeld des Bildes versetzen, um von verschiedenen Stand- und Fluchtpunkten aus, den Bewegungsrhythmus zu entfalten. Doch an der modernen Technik und ihrer Forschrittsgläubigkeit zeigt sich Feininger nicht interessiert und auch dem Prinzip der Simultaneität in der zeitgenössischen Großstadt steht er fern.
Harmonie und Dissonanz, Formstrenge und Rhythmik: „Meine Bilder nähern sich immer mehr der Synthese der Fuge“ stellt Feininger fest und die beschworene Analogie von Malerei und Musik überrascht auch nicht, war der Maler doch von Jugend an mit Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge vertraut. Er fand im Kontrapunkt von Dur und Moll, Stimme und Gegenstimme sowie der auf- und absteigenden Melodieführung die Entsprechung zu seiner eigenen Malerei. Bachs „Leitmotive“ mit ihren Phrasen und Wendungen kehren in Feiningers Variationen von Themen vor allem in den Gelmeroda-Bildern programmatisch wieder.
Kubisten wie Futuristen sind Erkenntnistheoretiker,
Feininger hingegen Metaphysiker.
Er stellt die Existenzform
des Gegenstandes nicht in Frage. Er schafft vielmehr Abbilder
einer Wirklichkeit, die er durch die Anwendung heterogener Stilmittel
zugleich der Wirklichkeit entrückt. Das Kristalline wird
ihm hierbei zunehmend zum Ausdruck einer solchen Erhöhung.
Der Kristall mit seinen komplexen Raumstrukturen, schillernden
Transparenzen und der strengen Regularität der geometrischen
Gebilde erschien den Malern seit der Romantik als Metapher für
die Immaterialisierung des Wirklichen zum Geistigen hin. Bei
Feininger kristallisieren sich Architektur und Natur in der Symbiose
zum Licht hin, in Stufungen von Körperlichkeit zu Unkörperlichkeit,
von greifbarer Undurchdringlichkeit bis zur Durchsichtigkeit,
von der Tiefe zur Ferne.
Im Gründungsmanifest des Bauhauses
in Weimar, dem Feininger 1919 beitritt, heißt es enthusiastisch:
„Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der
Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird: Architektur und
Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker
einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines
neuen kommenden Glaubens. Feininger schuf den Titelholzschnitt:
eine gotische Basilika, die als kristallenes Gebilde der Licht-Inkarnation
in den Kosmos einer erträumten Zukunft wächst. Auch
als einer der letzten Maler am Bauhaus wird Feininger unverdrossen
am traditionellen Staffeleibild und am Glauben an das Metaphysische
in der Kunst festhalten. Feininger konstruiert in seiner Malerei,
ist aber nie „Konstruktivist“.
Die sublime Lichtmagie von William Turner hat Feininger Zeit seines Lebens fasziniert. Doch die eigentliche Befreiung zur lichterfüllten Farbe kam erst durch den „Orphismus“ von Robert Delaunay. Auf die allzu strenge Flächenbezogenheit und gänzlich unmetaphysischen „Formes circulaires“ des Franzosen reagierte Feininger zwar ablehnend, doch am Prisma der chromatischen Transparenz kam er nicht vorbei:„Der Raum erscheint durchsetzt von prismatischen und pyramidalen Strahlenbündeln, er ist eine tektonische Ordnung von leuchtenden Spektralfarben, die als Lichtpyramiden und -rismen den einzelnen Zentren des rhythmischen Gefüges zuschießen, und die Objekte, die Bauten, leben doch darin in dauernder Existenz.“ Um sich gebührend von den anderen Stilrichtungen abzusetzen nennt Feininger seine Malerei der folgenden Zeit Prisma-ismus.
In den zwanziger Jahren nimmt Feininger seine lange unterlassenen Notizen vor der Natur wieder auf und erobert sich in seinen „Ostseebildern“ ein neues Gefühl für die Unendlichkeit und Weite des Raumes. Die Härte der kubo-prismatischen Malerei hat sich verloren, der lasierende Farbauftrag ist aufgelockert durch eine feintupfige Licht-Schatten-Modulation der Tonwerte. Sein Ziel ist die „transzendentale Raumbildung“ durch Überlagerung farbiger Flächen, in denen auch die letzten Reste des Materiellen im Gegenstand herauskristallisiert werden.
|
|


Je älter der Künstler wird, um so mehr zerrann ihm auch das Wirkliche. Die Erinnerung wird immer mehr zur Methode seiner Malerei. In den letzten Jahren verlieren Formen und Figuren ihren klaren Umriß. Im ersten Anlauf pastos aufgetragene Farben werden mit Sandpapier abgeschmirgelt und an anderen Stellen bis auf den Grund abgekratzt. Dann wird die Farbe wieder dünn aufgetragen. Das Ergebnis ist ein diffuses Farbgewebe, das mitgetragen wird vom Licht der Untermalung. Trotz der Sublimierung der sich auflösenden Farbform verraten die Bilder Züge der bildnerischen Ermattung, vor der die viele Maler im Alterswerk nicht gefeit sind.