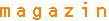| magazin |


Party im Museum?
Eine Diskussion im Stadtforum - zwei Meinungen
|
|
"Der Museeumsleiter ist eben zum Intendanten geworden. Er muß seine Häuser bespielen, und die Kunstwerke aufbereiten" rechtfertigte der Hamburger Kunstkritiker Axel Hecht diese Praxis auf einer Veranstaltung des Münchner Stadtforums am vergangenen Wochenende zum Thema "Party im Museum", der Frage also, was alles erlaubt ist, um die leeren Kassen der darbenden Kunsthäuser zu füllen.
Das Überraschendste
an der Diskussion war, daß Hechts Feststellung keiner der
Geladenenen wiedersprach. Im Gegenteil: "Die Kunst ganz allein
bringt es ja nicht." meinte auch Uwe M. Schneede, der Leiter
der Hamburger Kunsthalle, und wetterte gegen "das öffentliche
Gezeter, diese pharisäerhafte Haltung. Ich hab es satt,
witzige gute Ausstellungen zu machen, und keiner kommt." 4 bis
5 Millionen Mark jährlich müsse er in seinem Haus selbst
erwirtschaften. Das gehe nun einmal nicht ohne "33 exklusive
Events", bei denen das Museum außerhalb der regulären
Öffnungszeiten für ein ausgewähltes – teuer bezahlendes
- Publikum oder Veranstaltungen von Sponsoren zur Verfügung
gestellt werde.
Etwas andere Akzente setzte Christoph Vitali,
der seit Jahren im Haus der Kunst regelmäßige Nacht
- Programme durchführt: "Wer die Predigt unter die Leute
bringen will, muß zuerst die Kirche vollhaben". Vitali
gab sich als Menschenfischer, der Köder auswirft, um ein
maximales Publikum zu erreichen. "Die Kunst muß aus dem
Ghetto der Eliten raus, aus dem Elfenbeinturm. Es macht ja die
Sachen nicht schlechter, daß viele Menschen sie gerne sehen."
Spätestens hier zeigte sich, daß die Frage "Party im Museum" zumindest etwas ungenau gestellt war, und an der eigentlichen Problematik vorbeizielte. Denn keiner mag sich heute mehr ernsthaft über Versuche entrüsten, die einer leicht angestaubten Erziehungsanstalt durch "neue Spielregeln" (Hecht) und ein wenig Pop und Circumstances zu neuem Leben verhelfen und sie für ein breites Publikum öffnen. Ein großer Unterschied besteht hingegen zwischen Museums-Events, bei denen sich tausende von Besuchern zu Tanz- und Musikdarbieteungen vor den Werken tummeln, und den elitären Sponsoren-Führungen mit Menü, bei denen die Kunst allenfalls noch als kulturelle Sättigungsbeilage fungiert.
Die klassische Differenz zwischen öffentlicher
und elitärer Kultur bricht dort wieder auf, wo nach der
zukünftigen Finanzierung der Museen gefragt wird. Denn hier
geht es zugleich um die Funktion, die ein Museum überhaupt
noch im 21. Jahrhundert haben kann und soll.
Wieder war es
Christoph Vitali, der am klarsten Position bezog: Das Museum
ist ein öffentliches Haus. Wir werden unserer Aufgabe nicht
gerecht, wenn wir uns verschließen." Sein Plädoyer
für ein Mueum als Erfahrungsraum, das auch Neues und Sperriges
zuläßt, war zugleich eine Absage an jene „Refeudalisierungstendenzen“
die der Frankfurter Kritiker Eduards Beaucamp ausmachte: „Immer
die gleichen Namen, immer die gleichen Künstler - das ist
heute eine monopolistische Establishment-Kultur, die keinen Platz
für Alternativ-Kultur läßt“. Beaucamp forderte
private Stifter ein, die in klassischer Manier selbstlos beträchtliche
Mittel zur Verfügung stellen, und fand nur selbstsüchtige
Geldgeber.
Doch wie entgeht man der babylonischen Gefangenschaft
in der Abhängigkeit von Sponsoren? Offenbar geht es doch
nicht ganz ohne den Staat. Noch vor 10 oder 20 Jahren wurden
Museen serienweise gebaut. Aus der Verantwortung für die
Folgekosten der großen Prestigeprojekte hat sich die öffentliche
Hand klammheimlich herausgestohlen. Christoph Vitali will das
nicht zulassen: „Der Staat darf aus der Verantwortung für
die Kultur nicht entlassen werden. Das ist eine öffentliche
Aufgabe wie Gesundheitspflege oder Aufrechterhaltung der Ordnung.“
Freilich hat einer leicht reden, der in einer Stadt Ausstellungen
organisiert, die gerade ein dritte Pinakothek errichtet, und
wo auch der Freistaat kaum Kosten scheut, um den Glanz der weißblauen
Kunstmetropole zu nähren.
In Hamburg sind die Verhältnisse
hingegen schwieriger. Uwe M. Schneede blieb nichts übrig,
als für „Museumsmoral“ zu plädieren, und für Verständnis
zu werben: „Wir müssen selbst verdienen, um die eigentlichen
Aufgaben des Museums erfüllen zu können. Und das auf
nicht sittenwidrige Art.“
Rüdiger Suchsland
|
|
Ganz provokant die Aufmachung: „Hip Hop vor Hopper - Bringt’s Kunst alleine nicht mehr?“ Museen gehen vor die Hunde bzw. vor die eventsüchtige Jugend, das war damit gemeint. Geladen waren Eduard Beaucamp, Kunstkritiker der FAZ, Axel Hecht, Chefredakteur der ART, Uwe M. Schneede, Kunsthistoriker und Direktor der Hamburger Kunsthalle sowie Christoph Vitali, Chef des Haus der Kunst in München. Ordentlich beanzugt und kravattiert auf dem Podium aufgereiht, ließ sich bereits vermuten, was innerhalb der nächsten Stunde rüde Wahrheit wurde. Dort oben saßen Kunstbeamte, die sich joivial auf die Schulter klopfend einer Meinung waren. Schön und gut, aber fatal für eine Diskussion.
Nach emphatischer Einleitung von Peter M. Bode, dem moderaten Moderator, rückte Herr Schneede gleich die Tatsachen vor Augen. 5 Millionen müsse er selbst einspielen, das gehe nunmal nur mit „exklusiven Events“ außerhalb der Öffnungszeiten. Herr Beaucamp hob den Zeigefinger. Die öffentliche Hand dürfe nicht wie selbstverständlich von der Pflicht der Kulturpflege entlassen, die Museen nicht finanziell auf sich selbst gestellt werden. Vitali kam auf seine Parties zu sprechen und führte vor Augen, daß solche Veranstaltungen nicht dazu dienen, Geld in die Kassa zu bringen, sondern dazu, ein bisher unerreichbares Publikum ins Haus zu ziehen und ihnen dabei auch noch manierliches Benehmen vor Kunstwerken beizubringen. Das Gefährlichste für Kunstwerke wären sowieso Fernsehteams bei Ausstellungseröffnungen, dieser Rundumschlag gefiel allen Fünfen gleichermaßen. „Das Museum als Erziehungsanstalt“ bemerkte Axel Hecht daraufhin, der außerdem einwarf, daß die Zeiten, in denen sich mancher Grandseigneur der Kunsthistorik mit seinem Fachpublikum ins Museum einschloß, noch nicht allzulange vergangen sind.
Man streifte dieses und jenes Zipperlein der Museumswelt, plauderte über Merchandising, über Franz Marcs gelbe Kuh als Stofftier beispielsweise. Schneede stimmte zaghaft für die Kuh, Vitali gestand, Kunstreproduktionen absichtlich nicht bis zur Perfektion zu treiben, damit das Original daneben nicht an Geltung verlöre. McKinsey-Unternehmenstaxierungen für Museen fand Schneede nicht unnütz, das Leitbild der „semantischen Qualität“, das die Berater für Wien formulierten, rief nur Achselzucken hervor. Den Auftritt der Ruhrgas als Sponsor wurde belächelt, meinte dieses Industrieunternehmen doch, die Kunst für sich erfunden zu haben. Die Äußerung des Direktors der Mannheimer Kunsthalle, auf die „Einschaltquote“ bei Ausstellungen keine Rücksicht mehr nehmen zu wollen, wurde als naiver Idealismus gescholten. Positiv wurde dagegengehalten, daß zu Tübinger Ausstellungen alle drei Jahre die gesamte Bundesrepublik zu pilgern, dazwischen aber Funkstille zu herrschen scheint. Vitali wies darauf hin, daß auch gern gesehene Kunst gute Kunst sein könne. Kurz hielt man sich noch bei einem kürzlichen Skandal in Essen auf, wo die Vorführung der Jawlensky-Fälschungen auf die Einflußnahme eines Sponsoren zurückgeführt wurde. Verschmitzt gestanden aber Vitali und Beaucamp ein, daß auch sie einmal „schönen Zeichnungen“ aufgesessen seien, von denen sie noch heute nicht wissen, ob es sich um Fälschungen handelt. Beaucamp schimpfte außerdem auf Heinrich Klotz, der die Kunst der neuen Medien offensichtlich allen anderen vorzuziehen scheint, und deren Ausbreitung wie ein Krebsgeschwür vorantreibe.
Daß normalerweise bei derartigen Veranstaltungen auch dem Publikum ein Mikrophon zur Seite steht, wurde schlichtweg übergangen. Wozu auch auf unbequeme Fragen eingehen, es waren sich doch alle einig, wenn auch Herr Bode mehrmals verschmitzt als „advocat diaboli“ mit Plattitüden um sich warf. Die Frage ob mit oder ohne privatwirtschaftlichem Sponsor stellt sich heutzutage gar nicht mehr. Der zaghafte Ansatz Herrn Beaucamps’, daß die Politiker, die sich in den achziger Jahren mit der Eröffnung ganzer Batterien von Ausstellungshäusern schmückten, nun nicht mehr dafür aufkommen wollen, ging im Geplauder der Altherrenrunde sachte unter. Kompromisse sind an der Tagesordnung, allein das Überleben der Museen zählt. Unbequeme Fragerei war nicht angesagt. Hätte vielleicht einer mal erwähnen sollen, was so eine McKinsey-Untersuchung überhaupt kostet? Hätte vielleicht einer der Herren Museumsdirektoren gestanden, was in Museen verschludert wird? Es hätte sich auch jemand die Frage stellen können, ob Kunsthistoriker überhaupt dazu fähig sind, ein Haus ökonomisch und organisatorisch zu leiten, ohne jegliche Ausbildung dafür genossen zu haben, wärend sie doch hauptberuflich auch noch damit beschäftigt sind, an ihrem Namen zu polieren. Hätte doch jemand mal ganz defensiv Fehler eingestanden und erklärt, weshalb ein Museum solch eine Geldschleuder darstellt. Hätte nur einer Interesse an einer Veränderung gehabt. Das Publikum dankte die Diskussion, indem es scharenweise den Raum verließ. Und der Rest unterdrückte ein Gähnen. Wie schade.