  |
1 3 3
1 9 0 4 2 0 0 0
|
|
|
manfred faßler
|
||
|
10.10.1969, es war eine schwere Geburt. Aber die Sterne standen gut und so erblickte der Urahn unseres liebsten Haus- und Diensttieres das Licht der Welt: Interface Message Processor. Computer ward er fortan getauft – immens sein Umfang an Babyspeck, lautstark obendrein, gering noch – wie bei Neugeborenen nun nicht ungewöhnlich – sein Standvermögen. Der Mutterbrust entwöhnt folgten in den 70ern die ersten zaghaften sozialen Kontakte, Netzumgebungen für unseren lieben Compi. Kaum flügge flößten ihm die 80er schon seine wesentliche Bestimmung ein: Förderer einer belebbaren Umgebung für den Menschen zu sein. So fand Compi Einzug in unser aller Leben und mit ihm eine neue Künstlichkeit , die wir heute als unsere Kommunikations-, Handlungs- und Lebensgrundlage sehen. In den 90ern macht der Kleine dann so richtig Karriere: Demokratisch für die einen, totalitär für die anderen, auf jeden Fall Netzwerke für alle! – kleine Gemeinschaften und dann die großen zivilen globalen Netzwerke machen unsere gute alte Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. So eben aus unseren elterlichen Pflichten entlassen, müssen wir uns nun selbst - wie sich das für die ältere Generation nun ziemt - an einer Wirklichkeit neu orientieren, die unser Kleiner maßgeblich mitbestimmt. Wie stellen wir’s an? | |
|
Gedanken von Manfred Faßler anläßlich der Vortragsreihe: „Medienkunstperspektiven:" Wir leben in einer Welt der Bilder. Die Textkultur verliert an Grund. Das Bild selbst, oder das was wir einst dafür hielten, verliert seine Einzigartigkeit, wird pragmatisch. Das Bild ist nicht mehr wesentlich, sagt Faßler, es ist zeichenhaft und generiert. Bildwissen wird entwickelt und die Bildmoderne ist die Geschichte der Oberflächlichkeit – nicht unbedingt im abwertenden Sinn! Immerzu glaubten wir, daß die verschiedenen Medien alle fein säuberlich getrennt voneinander zu halten wären. Heute aber spricht man von Medienkongruenz. Da schnurren sie zusammen in computergenerierten künstlichen Welten, die Bilder mit den Texten, mit den Klängen, so daß Bildlichkeit von Schriftlichkeit garnicht mehr zu unterscheiden ist. Ihre Einzigartigkeit, ihre Unterscheidbarkeit hieß Wahrhaftigkeit. Kann man heute noch vom reinen Sehen, vom reinen Bild im Sinne einer traditionelleren Ästhetik sprechen? Dann gibt es die „Non optical images„ – die Computertomographie zum Beispiel. Die haben gar keinen Ursprung, keine Referenz mehr. Doch das Nichtsichtbare auf Bildern, gab es das nicht schon immer, wird gefragt. Der Mensch reagierte schon lange auf die Unzulänglichkeit seiner Sinne mit Modellen, so Faßler, die ihm das Nichtwahrnehmbare vorstellbar machten. Daraus entstand Kultur. Nichtsichtbarkeit war also immer ein Begleiter der Kultur. So war’s zumindest bis in die 40er Jahre des jüngst zu Ende gegangenen Jahrhunderts. Da tauchte jäh der Begriff der Information auf. Zuvor gab es keine Begriffe für Vorstellung, Imagination, Erkenntnis. Alles zusammen nannte man aber nun: Information oder Kommunikation. Ihre Wechselseitigkeit ist die Kybernetik. Im Grunde geht es heute um eine neue Ebene der Anwendbarkeit. Ein Erkenntnismodell ist nicht mehr nur Theorie und in Maschinen abgelagert. Die Trennung von Geist und Körper funktioniert nicht mehr und wir befinden uns unversehens am Übergang in die Sphäre des künstlichen Lebens. |
|
|
Nicht weit von Faßler entfernt bewegt sich Thomas Mitchell mit seiner Bildtheorie. Die Wende zur Sichtbarkeit ist vollzogen, das Bild ist reale Möglichkeit geworden. Die sinnliche Nische verliert seine Bedeutung. Unsere Kultur ist von Bildern beherrscht. Michel Foucault sprach für die Textkultur: „Das Imaginäre haust zwischen dem Buch und der Lampe.„ Doch das Imaginäre folgt nicht mehr dem menschenmöglichen Text, sondern den unmöglichen Alogarithmen, die im Bildhintergrund bleiben. Das Imaginäre muß den Bildern entnommen werden! Der Text wird verbildlicht genauso wie das Bild sich durch Anschauung verbildlicht. Das heißt wir müssen lernen Bilder auf die Distanz zu verstehen wie den Text. Das Bild ist nun mal keine direkte Berührung der Netzhaut. Wieso gilt Verbildlichung also nur für den Text? Etwas anders hatte sich Friedrich A. Kittler in seinen „Aufschreibsystemen„ ausgedrückt: Das Bild habe angeblich einen direkten Einfluß auf uns, der Text hingegen nicht. Fehler kann sich folglich nur der Text leisten. - Neurophysiologisch ist das aber bei weitem nicht geklärt. Da wäre es denn mal wieder an der Zeit einen Aufruf an die Kunstwissenschaftler zu starten, wie ihn Faßler in der Diskussion auch formuliert. Die Medientheorie kommt aus der Sprachwissenschaft. Höchste Zeit sich ihr aus anderen Bereichen zu nähern. Denn leben tun wir schon längst in einer multimedialen Welt. |
|

 |
 kunst in münchen suche |
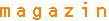 berichte, kommentare, archiv |
 meinungen, thesen, aktionen |
 kulturinformation im internet |