Gestrandet auf Corona Island
Die Erde und das Kapital |
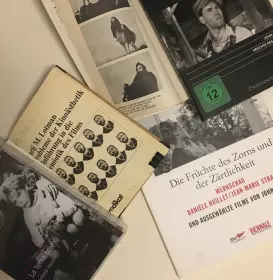 |
|
| Filme schauen zuhause kann manchmal ausufern | ||
| (Foto: Dunja Bialas) | ||
Filmeschauen in Zeiten der Corona: Der melodramatische Neorrealismo in Luchino Viscontis LA TERRA TREMA und die sozialistische Utopie in John Fords THE GRAPES OF WRATH
Von Dunja Bialas
La terra trema: der Mythos des Zyklopen-Kapitalisten
Beginn und Ende sind identisch in Luchino Viscontis La terra trema. Eine Flotte von Fischerbooten fährt in der Abenddämmerung auf die See hinaus. An Bord leuchten die Laternen, die ausfahrenden Boote haben das gleiche Ziel: möglichst viele Fische an Land zu bringen. Und doch hat in Aci Castello zwischen dem Anfang und Ende des Films ein soziales Erdbeben stattgefunden.
La terra trema, die Erde bebt. So ganz mag der Titel dennoch nicht zu dem Film passen, der überwiegend mit dem Element des Wassers zu tun hat. Der naturalistische Romanklassiker von Giovanni Verga (erschienen 1881) hieß so auch »I Malavoglia«, die Schlechtwünschenden, nach dem Namen der Romanfamilie. Die Handlung dreht sich so auch nicht um ein kollektiv erlebtes Ereignis, untersucht vielmehr, wie eine einzelne Familie sich außerhalb die Gemeinschaft stellt, um schließlich böse vom kapitalistischen System überspült zu werden.
Alle Fischer im Dorf arbeiten für den Großhändler »Ciclope«, eine Anspielung auf die »Zyklopeninseln«, die vor dem sizilianischen Hafenstädtchen liegen. Sie wiederum sind nach dem homerischen Zyklop benannt, der sechs Männer verschlang, bis sich seine ungeheuerliche Wut über den listigen Odysseus gelegt hatte. Das Geschehen nimmt also mythische Ausmaße, an dessen Ende zwar nicht sechs Männer verspeist wurden, dem aber doch eine ganze Familie zum Opfer fällt, die verschuldet und enteignet auseinanderbricht. Die Familie Voltara sagt sich vom »Zyklopen«-Großhändler los und macht sich mit ihrem Boot selbständig, wirtschaftet für sich. Das heißt aber auch: Ausfahren auch bei widrigen Wetterbedingungen. Enigmatisch ist die Einstellung, die Kameramann Aldo Graziati im dramatischen Höhepunkt des Geschehens gefunden hat. Die Frauen der Familie bauen sich als schwarze Silhouetten vor den markanten Zyklopen-Felsen auf, bilden ein figurales Äquivalent für die dem Mythos nach zornig hingeworfenen Felsen. Im Nu, in diesem einen Bild, hat man das Ausmaß der sich abspielenden Katastrophe erfasst.
Symptomatisch für den sozialen Niedergang sterben dann auch noch die Großeltern, die jüngere Tochter prostituiert sich, der älteste, handlungstreibende Sohn Ntoni verkommt in den Bars des Dorfes. Bis er reumütig und verarmt zum »Zyklopen« zurückkehrt.
Protest gegen die Künstlichkeit der Kunst
Kurz nach dem Krieg 1948 erschienen, wurde der Film zum Meilenstein des italienischen Neorrealismo. Spuren aus der jüngsten Vergangenheit finden sich noch an den Wänden, schon etwas verblasst ist das Graffito mit Hammer und Sichel an einer Hausecke, deutlicher zu lesen ist »Mussolini« an den Wänden des Großhändlers: eine starke Politisierung des menschenfressenden Kapitalisten.
Visconti hat mit Laiendarstellern gedreht, mit den Fischern von Aci Castello. So wirkt La terra trema besonders in der Exposition sehr dokumentarisch, in der man die Fischer bei ihrer Arbeit sieht. Aus dem Off kommentieren Luchino Visconti und sein Co-Drehbuchautor Antonio Pietrangeli das sich auf der Leinwand abspielende Geschehen. Das könnte dann zunächst auch ein Film des amerikanischen Dokumentarfilmpoeten Robert Flaherty sein, der 1934 mit The Man of Aran eine Fischerfamilie auf der irischen Insel Aran dokumentiert hat.
Gesprochen wird meist im sizilianischen Dialekt. Der russische Semiotiker Jurij M. Lotman merkt in seinem Band »Probleme der Kinoästhetik« 1973 an, dass der sizilianische Dialekt in der italienischen Originalfassung nicht untertitelt wurde, und der Film so kaum von den Italienern verstanden werden konnte. Er attestiert dem Film, »Protest gegen die 'Künstlichkeit der Kunst'« zu sein: »Besser ein unverständlicher Streifen, der durch seine dokumentarische Echtheit uneingeschränktes Vertrauen weckt, als ein verständlicher, aber des 'Ästhetizimus' verdächtiger Film.« Eine der konsequentesten Verwirklichungen der neorealistischen Poetik, folgert er.
Interessanterweise jedoch webt La terra trema alsbald einen zweiten Faden hinein, der sich mit der Handlung um die Frauen verbindet. Die Frauen: das sind die Mutter mit ihren Töchtern Mara, der älteren, und Lucia, der jüngeren, meist werden sie im Haus gezeigt. Sie halten den Haushalt in Ordnung, bereiten das Essen vor und beziehen die Betten, wie man das eben so macht, im Italien der 1940er Jahre. Ihr Medium zur Außenwelt, das sind die Fenster, die vor allem die ältere Mara gerne aufmacht, um nicht ohne Grund einen Basilikumstrauch besonders intensiv zu gießen: der Bauarbeiter Nicola, der vor dem Haus auf einer Baustelle arbeitet, sieht ihr dabei zu. Mit ihm flirtet sie lang und ausgiebig. Überhaupt ist sie dem Flirt nicht abgeneigt, wie man schnell merkt.
Mit der wirtschaftlichen Selbständigkeit der Familie ändern sich jedoch auch Rolle und Position der Frauen. Plötzlich müssen sie beim Geschäft mithelfen, gehen nach draußen und führen Verhandlungen, mit dem Salzhändler des Ortes. Auf dem Rückweg ist die Fuhre zu schwer, Nicola hilft Mara. Er gesteht ihr, dass er sie liebt, sie jetzt aber für eine Heirat nicht mehr in Frage käme, weil sie zu reich sei.
An dieser Stelle, dem Höhepunkt der Erfolgsstory, ist der Film unvermutet beim Melodram angekommen. Ein Eindruck, der sich mit dem Einsetzen der Abstiegsgeschichte verstärkt. Der Neorrealismo hat einen starken Hang zum Melodram, auch hier.
Am Tiefpunkt der Handlung gibt es einen eindrucksvollen Auftritt der ortsansässigen »Baronesa«. Nach einer langen Sequenz regengetränkter und dunkelgrauer Szenen scheint auf einmal wieder die Sonne. Man sieht, wie im Hafen Schiffe getauft werden. Die Schiffe sind ein Geschenk der altersschwachen, aber mondänen Baronesa, die mit ihrer Sonnenbrille wie ein Fremdkörper im Dorfgeschehen erscheint. Sie inkorporiert die alte, feudale Gesellschaft, die den Krieg entmachtet überstanden hat. Sie setzt jedoch immer noch auf das märchenhafte Mäzenatentum als eindrucksschindende Antithese zu den unerbittlichen kapitalistischen Marktmechanismen.
Intermezzo: die Corona-Brille
Unwillkürlich tun sich Parallelen zur aktuellen Corona-Krise auf: da ist das Wirken des sich selbst regulierenden Marktkapitalismus zu beobachten. Die Voltara-Familie führt exemplarisch das Risiko der Selbständigen vor, die durch eine von außen kommende Krise (hier: der Sturm, der ihr Fischerboot, also ihr Kapital vernichtet) unverschuldet in die Misere gerät. Schließlich haben wir mit der Baronesa eine Figuration des mäzenatenhaften Staats, der heute allenthalben mit seinen Soforthilfepaketen seinen Auftritt hat.
The Grapes of Wrath: Roadmovie auf der Route 66
Zur Sichtung von La terra trema schloss sich dann im selbstgewählten Home-Double-Feature noch Früchte des Zorns (The Grapes of Wrath) an. John Ford hat den Film mit Henry Fonda 1939, im Jahr, in dem auch Steinbecks gleichnamiger Roman erschien, gedreht. Auch hier ist die Verarmung einer Familie Motor der Handlung. Sie wird von Großgrundbesitzern in Oklahoma enteignet und bricht nach Kalifornien auf, wie so viele andere Landarbeiter vor ihnen. Im neuerlichen Sehen, und gerade im Kontrast zum puristischen Anfang von La terra trema, muss man jedoch die arg dialoglastigen Szenen im ersten Drittel des Films geradezu über sich ergehen lassen. Der Inszenierungsstil wirkt sehr hölzern, gedreht wurde im Studio. Die Dialoge, die ständig, äußerst ermüdend, die Vorgeschichte erzählen, hallen im Set. Das ändert sich jedoch schlagartig, als die große Fahrt gen Süden, das Roadmovie auf der Route 66 beginnt. Jetzt entwickelt der Film entlang der Begegnungen auf der Straße einen Sog. Immer wieder tut sich in den Totalen der Horizont auf, als das Bild strukturierende Linie, dramatisch türmen sich die Wolken, die Menschen hingegen sind nichts als schmale schwarze Silhouetten – eine kraftvolle, metaphorische Sicht auf das Universum von Kameramann Gregg Toland, der ein Jahr später Orson Welles' Citizen Kane fotografierte.
Mit der Ankunft im Lager der arbeitssuchenden Arbeiter ist der Film dann vollends bei sich. Mit subjektiver Kamera wird hier in die Misere hineingefahren, man kennt solche Einstellungen aus dem Direct Cinema, das aber erst viel später, in den 50er Jahren, in den USA entstand.
Früchte des Zorns – und der Zärtlichkeit
Diesmal ergeben sich, trotz aller Bemühungen, beim Sehen des Films keine Parallelen zur heutigen Corona-Zeit. Außer der ganz allgemeinen natürlich, dass der ausbeutende neokapitalistische Großgrundbesitzer viel mehr mit Donald Trump zu tun hat als der sympathische Sozialist der Regierung, der für humanitäre Verhältnisse in der provisorischen Arbeitersiedlung sorgt.
Interessanter als Corona ist zum Glück die Verbindung zum Werk von Straub-Huillet, die sich 2004 in der Viennale-Retrospektive »Früchte des Zorns und der Zärtlichkeit« konkretisierte. Dem soll noch nachgegangen werden. Und so kann man sich, anstatt Corona als Gegenwind zu nehmen, von ihr gemächlich durch die Filmgeschichte treiben lassen …
- Gestrandet auf Corona Island – unser Special zur Corona-Krise