Die Geflüchteten |
 |
|
| Ein Heimatgefühl | ||
| (Foto: IFFR | Golden Girls Filmproduktion) | ||
Traum, Trauma, Trauer: Die Seelenzustände der Flucht. Jonathan Millets GHOST TRAIL (Harbour) und Alexandra Makarovas PERLA (Tiger Wettbewerb)
Von Dunja Bialas
Das Gespinst der Rache: »Ghost Trail«
Graublau ist die Realität in Strasbourg, die Hamid auffängt. Er ist aus Syrien gekommen, mit dem ersten sogenannten »Flüchtlingsstrom«, es ist das Jahr 2014. Die Nachrichten machen den Umlauf, dass die Syrer nach Deutschland gehen sollen, dort werde man gut aufgenommen, könne seine Familie leicht nachkommen lassen. Auch Hamid hat den Asylstatus für Deutschland bereits in der Tasche. Aber er zieht seine Kapuze noch ein wenig höher, versenkt die Augen noch ein wenig tiefer in die Höhlen. Bleibt in Strasbourg. Er ist Teil einer Untergrundgruppe, die Leute von Assad aufspüren, die Asyl beantragen wollen. Jetzt ist er auf den Spuren von Harfaz, dem Mann, der ihn im Sednaya-Gefängnis gefoltert hat.
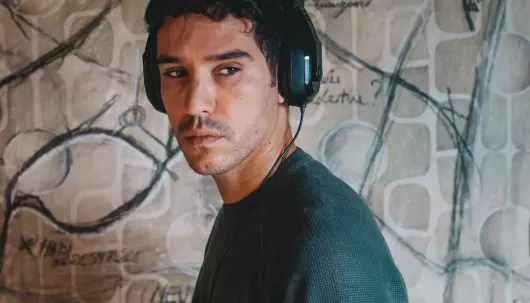
Doch so klar ist das dann auch wieder nicht. Hamid, gespielt von Adam Bessa mit stechend-leerem Blick, den man in einer ähnlichen Rolle schon vor zwei Jahren in Lofty Nathans Harkam sehen konnte, verliert sich zunehmend in der nicht belastbaren Vorstellung, seinen Folterer gefunden zu haben. Flashbacks vom Gefängnis und der Flucht zementieren seine Entschlossenheit, die ihn wie einen Geist durch Strasbourg wandeln lässt. Immer wieder verdeutlicht die Kamera, wie sein Blick verstellt ist. Das Foto, das er von Harfaz mit sich trägt, zeigt ihn unscharf, in der Bibliothek, in der er ihn heimlich fotografiert, erwischt er zwischen den Bücherregalen nur seinen gesenkten Blick. Mehr und mehr versinkt das Bild im Dunkel der Innenräume und in der grauen, kalten Stadt.
Jonathan Millet ist ein Quereinsteiger, der jahrelang mit seiner Kamera Bilder von schwer zugänglichen Regionen der Welt für Datenbanken geliefert hat, darunter aus dem Iran und dem mittleren Osten. Mit seinem Protagonisten fährt er nun auch in die steinige Badia-Wüste, in der das Assad-Regime die politischen Inhaftierten aussetzt, um sie loszuwerden. Sie sind die »Dead Men Walking«, von denen Giorgio Agamben sprach, als er die »Muselmane« mit den leeren Blicken in den KZs beschrieb (»Was von Auschwitz bleibt«). Sie werden ohnehin nicht überleben, sagt einer der Männer, der die Gefangenen aussetzt. Hamid ist ein Totgesagter, ein Zombie, der nun inmitten von Strasbourg angekommen ist.
Ghost Trail wurde letztes Jahr in Cannes als Eröffnungsfilm der Semaine de la Critique uraufgeführt; in Rotterdam auf dem Internationalen Festival läuft er in der Reihe »Harbour«, die sprechender und passender kaum sein könnte für diesen Film über eine Flucht ohne Ankunft; in diesem denkwürdigen Januar 2025 kommt er mit aller Brisanz auf die Leinwand.
Da erkennen wir die Standardsettings der Attacken, die uns die Zeitungsberichte in den letzten Wochen eingebrannt haben: wir sehen einen Spielplatz, auf dem Hamid wie im Spionage-Klassiker von seiner Untergrundgruppe Hinweise auf Untergetauchte des Assad-Regimes zugeschoben bekommt; wir sehen einen Weihnachtsmarkt, auf dem Hamid und Yara (Hala Rajab) – die einzige Person, mit der er überhaupt so etwas wie zwischenmenschlichen Kontakt hat – und auch Harfaz und seine französische Freundin von süßem Honig probieren.
Der auch mit deutschen Geldern produzierte Ghost Trail – eine kurze Episode führt in das Land, das den Syrern relativ schnelle Ankunft garantiert, Merkels »Wir schaffen das« ist allgegenwärtig – zielt mitten in den Kern aktueller Debatten und in die politische Großwetterlage. Noch den Nachhall der niederschmetternden Geschehnisse rund um das sogenannte »Zustrombegrenzungsgesetz« im Kopf, geschieht während des Sehens ein permanenter Realitätsabgleich. Man sieht sozusagen in den Kopf von Hamid hinein, und anerkennt: Die Realität, die er in sich trägt, ist nicht die von Strasbourg, das sind seine tote Frau und die Tochter, deren Foto er in anhaltender Trauer im sandigen Boden von Aleppo vergräbt. Und auch das alte Gespinst der Rache durchquert dieser anspielungsreiche Thriller. In Jonathan Millets Film hallen die Bilder des gewaltvollen Bürgerkriegs unerbittlich nach, das ist der unerbittliche Zugriff der vergangenen Gewalt auf die Gegenwart, die auch im Exil noch wirkt.
Hinter dem Eisernen Vorhang: »Perla«

Von einer anderen Flucht erzählt Perla, einer Flucht, die auch mit der Geschichte der Deutschen zu tun hat. Die österreichische Regisseurin Alexandra Makarová taucht ein in die Bohème im Wien der Achtzigerjahre. Perla (Rebeka Poláková) ist eine Künstlerin, die in Öl sehr dunkle Universen schafft, die Gesichter tragen grobe Farbzüge, ihre Settings sind dunkle Wälder. »Ich halte nichts von Subtilität«, sagt sie. Sie kommt aus der Tschechoslowakei, ist über die grüne Grenze aus dem Eisernen Vorhang geflohen, schwanger. Ihre Gemälde, das buchstabiert auch der Film aus, sind Versuche der Bewältigung einer äußerst dunklen Episode auf dieser Flucht. Die Ereignisse von damals sind hier, im Wien der Künstler und großen Wohnungen, auch nach vielen Jahren – ablesbar an der herangewachsenen Tochter – gegenwärtig. Mit Josef (Simon Schwarz) beginnt sie schließlich ein neues Leben, heiratet ihn. Ihre Vergangenheit verschweigt und übertüncht sie wie sie ihre Haare blondiert – alles ist Abwehr, Wille, zu vergessen, alles hinter sich zu lassen. Und dann kehrt die Vergangenheit mit einem Telefonanruf brachial zurück – Andrej (Noel Czuczor), mit dem sie einst geflohen war, kommt aus der Haft frei.
Alexandra Makarová zeigt in ihrem zweiten Film, der in Rotterdam im Tiger Wettbewerb für den besten Nachwuchsfilm konkurriert, ein großes Gespür für die richtige Tonlage. Die 4:3-Bilder evozieren die Vergangenheit, das sorgfältig farbkorrigierte Bild simuliert Zelluloid. Viele Gesten der vergangenen analogen kulturellen Praxis strukturieren den Alltag: Platten werden aufgelegt, Klavier wird gespielt, Farben werden gemischt. Dazwischen klingelt in die Stille hinein das Telefon, ein roter, alarmistischer Apparat. Es ist nie vorbei, auch davon erzählt Makarová, die viele Themen ihrer eigenen Herkunftsgeschichte verarbeitet: die Mutter-Tochter-Beziehung, die Malerin ist von der Großmutter geliehen, der slowakische Herkunftsort ihrer Protagonistin, die Geschichte der Flucht, auch wenn Makarová um vieles jünger war als Perla, schließlich: die Ehe von Perla mit der Figur von Simon Schwarz, mit dem Makarová im richtigen Leben verheiratet ist. »Mein ewiges Thema und ewiger Kampf mit der Mutter und dem Heimatgefühl und die Frage, wo liegen meine Wurzeln und wo bin ich eigentlich zu Hause?«, darum gehe es ihr, sagt sie im Gespräch. »Hab ich noch ein Zuhause?«, fragt Perla Josef, kurz bevor sie die Tschechslowakei, ihre alte Heimat, nicht mehr verlassen kann.
Die Sehnsucht nach der Heimaterde ist überaus stark, wie in Ghost Trail. Perla gräbt bei ihrer Rückkehr mit beiden Händen in der Erde von Košice, um eine kitschige Figur, eine Art Totem, hervorzuholen. Sie ist zurückgekommen, damit der Vater die Tochter kennenlernen kann, auch, weil für sie etwas noch nicht abgeschlossen ist. Sie konnte sich nicht verabschieden. Als sie ein zweites Mal klammheimlich den Ort verlassen will, wird sie gestellt und in eine grausame Tradition hineingezogen: Frauen werden von den Männern gejagt, ins Wasser geschubst, bis ihnen unter Todesangst die Kräfte schwinden, und der Wille. Eine Szene, die eindrücklich symbolisiert, dass es nicht nur das System war, das den Freigeist von Perla einst herausgefordert hatte.