Dokumentarische Bilder in frei schwebenden Situationen |
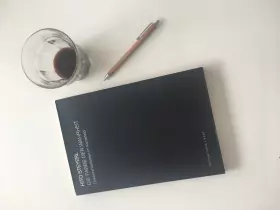 |
|
| »Dokumentarismen im Kunstfeld« – Das Überlebenskit | ||
| (Foto: artechock) | ||
Über Hito Steyerls »Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld« (2008)
Von Nora Moschuering
In den letzten Tagen habe ich mir Inseln erstellt, auf denen ich stundenweise, mit Perspektivwechseln, mein Leben zubringen kann. In der Küche: die Stühle am Küchentisch. Ein recht gemütlicher Platz auf dem Sofa. Es ist schön – aber natürlich energietechnisch schlecht –, wenn ich die Heizung anmache. Sie wärmt dann aber meinen Nacken von hinten. Morgens und bis zum frühen Nachmittag ist es in der Küche recht hell. Dann ziehe ich in mein Zimmer. Vier Inseln. Das ist nicht schlecht für den Raum. Das ist nicht schlecht für mich. Ich kann am Schreibtisch an der Wand sitzen. Da klebt ein Post-It: »Ab jetzt ist: Alles wird gut.« Na dann. Auf meinem Sessel mit der Fußablage, aus dem Besitz einer 103-Jährigen, die ins Altenheim umgezogen ist. Mein Bett, in dem ich aber reflexartig einschlafe. Der kleine Teppich davor. Insgesamt sechs Orte, nicht übel denke ich. Youtube, Netflix, Amazon Prime, Kammerspiel-Videos, öffentlich rechtliche Fernsehsender. Ich bin in einem Zapping-Modus. Ich gucke alles, aber oft nicht zu Ende und wechsle dabei meine Sitzorte.
Das zur Situation. Ich habe die Rede von Merkel angesehen und dann die von Macron. Er sprach von einem Krieg. Trump spricht mittlerweile auch von einem Krieg. Ein Gesundheitskrieg gegen einen unsichtbaren Gegner. Sichtbarkeit. Ich muss mich sortieren. Ich sortiere mich. Ich habe Zeit und hole ein Buch hervor, das mir dazu einfällt. Ich lese es zuerst auf der Couch, dann an meinem Schreibtisch, auf dem Teppich, in meinem Bett (ich schlafe ein, das liegt wie gesagt am Bett). Ich lese selten Bücher ein zweites Mal. Aber jetzt lese ich Hito Steyerls »Die Farbe der Wahrheit« wieder. Ich habe es mir letztes Jahr extra zu meinem Geburtstag gewünscht, weil ich es besitzen wollte.
Hito Steyerl
Hito Steyerl hat an der HFF München Dokumentarfilm studiert und in Wien an der Akademie der Künste in Philosophie promoviert. Sie ist Professorin an der Universität der Künste in Berlin. In ihren essayistischen Dokumentarfilmen Die leere Mitte (1998), Normalität 1-10 (1999, schon unbedingt wieder anzusehen aufgrund des heute wieder verstärkt auftretenden Antisemitismus und dem Erstarken der Rechten), November (2004,) und Lovely Andrea (2007), aber auch in ihren künstlerischen Arbeiten und Texten setzt sie sich mit den Medien, der Verbreitung von Bildern und ihrer Verwobenheit in das politische Geschehen auseinander. Form und Inhalt bedingen sich dabei gegenseitig. In dem Tutorial: »How not to be seen: a fucking didactic .MOV file« (2013) geht es um Sichtbarkeit, aber auch um das Recht auf Verschwinden. Sie thematisiert das kapitalistische System in Factory of the sun (2015) oder schreibt über die Verstrickungen des globalen Kapital- mit dem Kunstmarkt in dem Essayband »Duty Free Art« (2017). Viele ihrer Texte kann man auf der online-Plattform e-flux finden. In der jetzigen Situation sehr praktisch, macht aber bei ihren sehr aktuellen Texten ohnehin Sinn, denn das ein oder andere Mal wurden sie von (technischen) Entwicklungen überholt. Auch in »Die Farbe der Wahrheit« passiert das, das tut aber den Ideen, den Denkrichtungen, den Überlegungen keinen Abbruch, sie bleiben wichtig und aktuell. Es bleibt ein Buch, das meinen Blick auf dokumentarische Bilder geprägt hat, und das ich unbedingt zum dritten Mal lesen werde.
Die Farbe der Wahrheit
Das Buch fasst Vorträge und Essays zusammen. Ganz grob geht es um die aktive Rolle von Bildern, die die Realität schon lange nicht mehr nur abbilden, sondern (mit)hervorbringen. Sie behandelt die Bilder als Subjekte, die aber gleichzeitig auch Objekte werden können.
Sie sucht Bilder, Filme und Kunstwerke, löst sie aus ihrer Verankerung, sieht sie sich in den unterschiedlichen Umgebungen, in denen sie vorkommen, an, den Kontext, in den sie gesetzt werden, und schaut, wie sie funktionieren. Da sind zum Beispiel die unscharfen Bildern aus den ersten Tagen der Irak-Invasion aus dem Jahr 2003. Mangelnde Auflösung, grüngraue, sich bewegende Farbflächen, die aber – vielleicht ja gerade deshalb – als dokumentarisch beurteilt werden, als authentisch, als echt. Später beschäftigt sie sich mit den »Schein«-Dokumenten, die Colin Powell 2003 dem Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen präsentiert hat und die belegen sollten, dass der Irak im Besitz von Massenvernichtungswaffen ist. Dokumente, die so wahrscheinlich bei keiner Gerichtsverhandlung durchgegangen wären, führten zum Krieg, sollten zum Krieg führen. Bilder werden benutzt. Manche Bilder wirken so in die Zukunft stärker als in die Vergangenheit, genauso wie Bilder eine dominante Ideologie als echt und wahr verbreiten können.
Steyerl denkt sich durch Bilder und künstlerische Arbeiten und verschiedene Arten der Repräsentation. Was macht das dokumentarische Bild aus? Was gilt als authentisch und echt, und wie sieht es 12 Jahre später aus? Jetzt wo die Qualität von Consumer-Produkten massiv zugenommen hat und die Produktionsmittel zumindest scheinbar in den Händen aller liegen? Was also sind Fakten und was ist Fake? Und welche Hinweise oder Informationen brauchen wir, um das einschätzen zu können – und welche Rolle spielen dabei unsere Gefühle?
Zurück zu Steyerl: in den Essays bespricht sie Arbeiten von Deller & Figgis, Ataman, Fast, Farocki & Ujica, Vertov, sie zitiert Agamben, Nancy, Foucault, Rosler, Adorno, Benjamin, Krakauer, Žižek und viele mehr. Sie macht das dabei immer verständlich und anschaulich. Man muss weder die Arbeiten kennen noch gelesen haben. Es sind Assoziationsanstöße, Denkbewegungen.
In einem Text behandelt sie das Thema Zeugenaussagen und das Vertrauen, das man in sie setzt und wie es möglich ist, trotzdem – zumindest einigermaßen – objektiv zu sein. Leider gibt es ganze Bevölkerungsgruppen, die bisher von der Artikulation ausgeschlossen sind, die nie zu hören sind. So gibt es also immer einen Zweifel am Zeugnis, dennoch ist es wichtig, in einer Gesellschaft Zeugnis abzulegen. In ihrem Essay über das Archiv schreibt sie: »Dokumentarische Arbeiten sind Paläste der Erinnerung, die im Gegensatz zu Archiven Dokumente nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit ordnen.« Sie sortieren Dokumente nicht nur, sondern stellen Zusammenhänge her und haben damit sowohl einen affektiven als auch einen informativen Charakter. Die Vorderseite eines Bildes dient als Spektakel, die Rückseite mit Vermerken und Herkunftsnachweisen verortet es.
Ein Essay möchte ich – wie schreiben gerade alle in ihren Schaufenstern: »aufgrund der aktuellen Situation« – herausstellen: »Die unterbrochene Gemeinschaft.« Der eigentliche Text ist komplex, sie schreibt u.a. über Sinn und Gefahr von Mythen und bezieht sich dabei auf Jean-Luc Nancy. Im Text geht es aber auch darum, wie eine Gemeinschaft zusammenhält, die nicht mehr um einen Geschichtenerzähler herumsitzt, sondern isoliert, als Individuen und Kleingruppen vor einzelnen Fernsehern, heute Bildschirmen, sitzt. Natürlich erschafft eben genau das eine Verbindung: Dass es uns, eben jetzt, allen so geht. Man ist durch die Form der Trennung verbunden. Aber das Netz ist, anders als der Fernseher, von dem Steyerl schreibt, ein responsiver Raum. Die Frage aller Social-Media-Fragen also: Verbindet uns das Netz, oder trennt es uns? Vertovs Traum der Proletarisierung der Produktionsmittel und einer länderübergreifenden Kommunikation durch Bilder habe sich durch das Internet erfüllt, schreibt Steyerl in einem anderen Essay – und zugleich ins Gegenteil verkehrt: »Wir teilen nur die immer gleichen Inhalte mit Leuten, die uns ähnlich sind, in immer normierteren Anwendungen, die von immer weniger Monopolisten kontrolliert werden. Es kommt darauf an, sich neu zu vernetzen.« Steyerls Videos, Essays und Vorträge machen das.
Das Essay
Als transnational, ungebunden, radikal selbstständig, modular und problemlos in neue Verkettungen und Netzwerke integrierbar beschreibt sie in ihrem Nachwort das Essay als Form. Ich muss dabei an ihr 2011 erschienenes Essay »The essay as conformism? Some notes on global image economies« denken (na ja, ich werde erinnert und lese es wieder). Sie beschreibt darin Essays – erst einmal in ihrer schriftlichen Form – als neoliberale Subjekte, die auseinandergenommen und in Einzelteile zerlegt werden, die überall andocken und mit anderen zusammengesetzt werden können. Seine Mobilität, seine Unabhängigkeit machen es zu einem Nomaden. Das Essay ist für sie aus diesen Gründen neoliberal, Ausdruck unserer Zeit. Laut Steyerl besteht aber Hoffnung auf seine kritische Kraft. Es kann neue visuelle Verbindungen schaffen, die jenseits der kapitalistischen, medialen Fließbänder schauen und alternative, visuelle Kulturen aufzeigen. Kritische Essays sind dazu fähig, momentane soziale Spannungen festzuhalten und in dialektische Bilder umzusetzen. So decken sie nicht nur Spannungen auf, sondern greifen in die Widersprüche ein.
Ein Text von Steyerl ist übrigens auch in der aktuellen Sammlung von e-flux Texten zum Thema Ansteckung zu finden.
Ein Essay von mir über ein Bild von einem Virus
Es ist halt einfach sehr klein: 120-160nm plus Hülle und Spikes – die machen aus den Nanometern allerdings auch nicht etwas, das für uns sichtbarer ist. Wir werden ihm also einerseits nie wirklich begegnen, können es andererseits nicht umgehen, wenn es uns auf der Straße entgegenkommt oder es ausladen, wenn es eine Party crasht. Irgendwie paradox so ein Virus. Wir sehen nicht, dass es aussieht wie ein Planet mit Bäumchen drauf oder eine Kugel, die besonders viele Menschen verschluckt hat, von denen nur noch die Beine herausragen. Es sind (elektronen-)mikroskopische Aufnahmen, dokumentarisch, aus einer Sphäre, zu der wir mit unseren Sinnen niemals Zugang haben würden. Wir sehen nur das Resultat, nicht den Urheber. Menschen, die beruflich viel mikroskopieren, haben sicher auch einen anderen Zugang dazu. Ich mikroskopiere eher gar nicht. Aber ich weiß, wie nachhaltig mich der Film Mikrokosmos – Das Volk der Gräser aus dem Jahr 1995 beeindruckt hat und nicht nur, weil es einer der wenigen Kinofilme war, denen wir einen Schulausflug widmeten. Die Zeichentrickserie »Es war einmal ... das Leben« von 1986 könnte man jetzt auch aktualisieren. Da gibt es Viren, aber die sehen ganz anders aus als das Coronavirus. Dass Terrence Malick kosmische Effekte mit Farben und Wasser in einer Petrischale simuliert hat – mal sehr vereinfacht dargestellt –, um Bilder für seinen The Tree of Life 2011 zu finden, dreht die Sache auf schöne Weise um, hier werden in etwas ganz Kleinem Bilder für etwas ganz Großes gefunden. Es sind aber Ersatzbilder, künstlich erschaffene Bilder, dokumentarisch sind sie nicht, nur eben, wenn man sie als Farbschlieren in Wasser zeigt und nicht als Universum. (Obwohl das Universum ja auch mal sehr klein war, dicht und heiß, bevor es begonnen hat, sich rapide auszudehnen, dann wäre Malicks visuelle Simulation gar nicht so weit entfernt.)
Zurück zum Virus. Es zeigt ja auch, jenseits der Bilder, die man davon machen kann, dass man etwas nicht mit bloßem Auge sehen muss und man es trotzdem für authentisch halten kann, ja sogar muss. Als Beweismittel/Dokumente sind die Mikroskop-Aufnahmen hilfreich. Da ist auch die Unschärfe und Wackligkeit, von der Steyerl 2008 schreibt, gar nicht nötig, weil sich die Möglichkeit der höheren Auflösung in fast allen Bereichen mittlerweile ergeben hat. Die Aufnahmen werden besonders durch ihre Kontextualisierung wichtig, durch die Kombination mit Informationen, wie Steyerl schreibt: ihre Rückseite. Aber auch mit ihrem Zusammenhang zu Bildern, die danach kommen, Bildern ihrer Auswirkung – auch wenn es sicher einfacher ist, Rambo mit einem blauen Auge in Verbindung zu bringen, als das Bild des Virus mit Menschen, die beatmet werden müssen – aber das auch nur solange, wie es für uns neu ist.
An sich ist das Bild eines Virus ein Bild, das wir nur schwer interpretieren können, zumindest die meisten davon. Es sagt erst einmal wenig. Vielleicht erweckt es Neugier oder wir bringen es in Verbindung mit anderen mikroskopischen Bildern. Auch affizierend wirkt es nicht, und das wird es vielleicht auch nie tun, weil es trotz allen Wissens so abstrakt ist. Hier, bzw. auch schon früher, trennen sich Steyerls Überlegungen zu unscharfen, verwackelten, affizierenden Bildern vom Virus. Auch diese Bilder sind ästhetisch abstrakt, aber inhaltlich, durch die Kontextualisierung, egal, ob wahr oder falsch, wirken sie affizierend. Das Bild des Virus zielt auf keinen Effekt, es ist erst einmal eine Information, eine Information, die wir gerade mit Inhalt füllen. Ob das Virus-Bild aber jemals, wie sagt man im Film so gerne: »Angst und Schrecken« auslösen wird, bleibt fraglich. (Auch Bilder von Krebszellen tun das wahrscheinlich nicht, sicher bin ich mir dabei aber nicht.) Das Bild des Virus ist ein dokumentarisches Bild, das echt ist, ein Fakt. Der Virus produziert weitere dokumentarische Bilder, seien es leere Straßen oder überfüllte Krankenhäuser, Ärzte und Krankenschwestern, die Schilder mit dem Aufruf »daheim zu bleiben« in die Kamera halten, Menschen mit Gesichtsmasken, Balkonkonzerte. Trump hat irgendwie einen konkret unkonkreten Gegner bekommen, der sich schwer instrumentalisieren lässt. Obwohl, das bleibt abzuwarten, denn die Gefühle, die seine Auswirkungen erzeugen, können das natürlich schon.
Der unsichtbare Gegner, als Motiv im Film scheint filmisch erst einmal sehr unattraktiv zu sein. Rambo, der Terminator, Godzilla, Kaiju, das Alien, der Predator, alle Widersacher von James Bond, Darth Vader, Moriarty, der Joker ... ein guter Held kann nur an der Größe/ Stärke seiner Aufgabe, also seines Widersachers gemessen werden. Und wenn der gute Bilder liefert, also jetzt mal physisch schon krass unbesiegbar erscheint und damit auch gute Action möglich ist, dann ist das meist essentiell für Actionfilme. Nichtsdestotrotz ist einer der aktionsreichsten, unheimlichsten Gegner sicher der so gut wie nie sichtbare Hai in Spielbergs Der weiße Hai. Auch das Alien, das Schatten- oder Mindflayer-Monster aus der Serie »Stranger Things« und auch viele andere, besonders natürlich Geisterwesen, sind unsichtbar meist unheimlicher als in dem Moment, in dem man sie sieht. Und dann gibt es noch die Filme mit einer sehr mystischen Art von Gegner, wie in Tarkowskis Solaris oder Kubricks 2001 – Odyssee im Weltraum oder eben Seuchenfilme wie Petersens Outbreak oder Soderberghs Contagion – aber das sind keine Actionfilme. Visuell uninteressant sind unsichtbare Gegner also nur im ersten Moment, weil in ihrem Bild – wenn es denn eines gibt – nicht ihre Stärke zu sehen ist. Oft ist es aber die Anzahl und eben dieses Ungreifbare, das es noch gefährlicher macht. Wo ist es? Wie kann man sich dagegen wehren? Wann hat man es besiegt? Dazu kommt, dass dieser unsichtbare Gegner sich an unseren Körpern vergreift und das ist wohl das Gruseligste, was passieren kann.
In diesem Sinne, aus dem Fenster auf die Straße: »Live long and prosper.« Bleibt zu Hause, lest und guckt Filme.
Hito Steyerl, Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld. Verlag Turia + Kant, 2008. 18,00 €
- Gestrandet auf Corona Island – unser Special zur Corona-Krise
- Support my local bookstore! Nora Moschüring empfiehlt Buchbestellungen bei der Büchergalerie Westend.